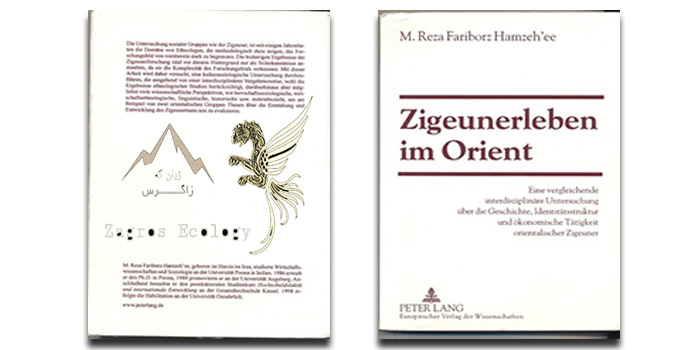book introduction
Ziguenerleben im Orient von Fariborz M. Reza Hamzeh’ee
تجربه زیگ در شرق مطالعه میان رشته ای تطبیقی تاریخ، ساختار هویت و فعالیت اقتصادی زیگ های شرقی.
اولین آفرینش کیهانی یک مروارید درخشان به نام «حکمت» بود. سه خصلت به آن نسبت داده شد: علم به حق، خودشناسی و معرفت به نیستی در پس وجود. سهروردی (فیلسوف ایرانی قرن دوازدهم)
اکنون به رویکردی تبدیل شده است که به سختی مورد تردید قرار می گیرد که کار علمی عینیت را می رساند. با وجود اینکه نقش ذهنیت اغلب در سالهای اخیر مورد بحث قرار گرفته است، اما خود دانشمندان علوم اجتماعی سعی میکنند بین خود و افرادی که میخواهند مطالعه کنند مرزی قائل شوند. نقش سوبژکتیویته افراد مورد بررسی، اگرچه بر آن تاکید شده است، اما آگاهانه یا ناآگاهانه به اندازه ای ساده شده است که به دلیل مشکلات روش شناختی موجود، تنها می تواند کمک محدودی در توضیح پدیده ها باشد. در نظر گرفتن ذهنیت افراد مورد تحقیق و تنوع عوامل تأثیرگذار بخش مهمی از رویکرد تحقیق در مورد پدیده های اجتماعی است، اگرچه باید در نظر داشت که سایر عوامل نیز از اهمیت کمتری برخوردار نیستند.
پیشگفتار
در ۱۹۶۱، استیت تامپسون بر این عقیده بود که وقتی صحبت از ادبیات عامهپسند میشود، ایران «تقریباً کاملاً ناشناخته» است. تا به امروز تغییر چندانی در این زمینه صورت نگرفته است – ما به یافتههای اوریوال (1986) و رائو (1982) اشاره میکنیم – و میتوان به راحتی این بیانیه را به گروههای حاشیهای یا اقلیتهای قومی که «کولیها» به آنها میپردازند تعمیم داد. شمرده شود .
نویسنده با پروژه تحقیقاتی خود که با پایان نامه توانبخشی وارد مرحله نگارش علمی شده است تا حد زیادی وارد قلمرو جدیدی شده است. او در انجام این کار، خود را به تحقیقات میدانی که به اصطلاح نامشخص و به شانس واگذار شده محدود نمی کند، بلکه به دنبال این پرسش قابل توجه است که تا چه حد می توان رابطه (اجتماعی) بین هویت «کولی» برقرار کرد. و فعالیت های اقتصادی نشان داده شده است.
رویکرد ارائه شده در اینجا بسیار موجه تر است زیرا از یک سنت اثبات شده و موفق پیروی می کند که به تحقیقات اجتماعی-قوم شناسی می رسد. قبل و اندکی پس از آغاز قرن، مارتین بلاک، آنتون هرمان و هاینریش فون ولیسلوکی «تحقیقات کولی» خود را بر اساس مسئله «فرهنگ مادی کولی ها» و به موازات آن، ماهیت پدیده های فرهنگی روزمره مانند ادبیات و موسیقی مورد تحقیق قرار گرفت، که تا حدی نمایانگر درآمد و معیشت گروه های مورد بررسی بود و بنابراین به هیچ وجه با «زندگی کاری» به معنای رایج در تضاد نبود.
نویسنده سؤالات ذکر شده را به مشکل تعریف گروه های اجتماعی مورد علاقه خود و جستجوی عواملی که اساساً هویت آنها را به عنوان «کولی» تعیین می کند، پیوند می دهد. نگارنده در اجرای علاقه پژوهشی تا حد امکان از روش های میدانی خاص یعنی مجموعه مصاحبه های روایی و مشاهده مشارکتی استفاده کرده است.
تجربه زیگ در مشرق زمین
او معمولاً فقط از طریق تماس های شخصی به میدان دسترسی پیدا می کرد. همانطور که پیداست، نقطه شروع مطالعات قومی-جامعه شناختی مانند این در موارد فردی در طول صد سال گذشته آسان تر نشده است. رزروهای مختلف ناشی از گروه مورد نظر غالباً با ملاحظات و مقررات اداری، قانونی و سیاسی مقامات و نمایندگان آنها همراه یا تحت الشعاع قرار می گیرد.
Großangelegte Feldstudien mit der Erhebung „harter“ Daten sind in bezug auf Minderheiten und Randgruppen einer Gesellschaft nach wie vor kaum zu erhalten – was keineswegs zu bedauern ist. Der Prozeß der Datengewinnung, wie ihn der Verfasser einleitet, betreibt und uns schildert, ist ungleich wertvoller als ein bei einer größeren Stichprobe gewonnener Datensatz auf der Basis eines standardisierten Befragungsbogens. Dies muß bei der Beurteilung des empirischen Teils der Arbeit zu Gunsten des Verfassers bedacht werden.
Um nicht wissenschaftlich in die Irre zu gehen, hat sich der Autor im übrigen entschlossen, die gewonnenen Ergebnisse seiner Untersuchung mit dem Mittel der Vergleichsmethode zu weiteren Untersuchungen in Beziehung zu setzen. Die Untersuchung der indischen „Zigeunergruppe“ wird durch den Vergleich mit zwei weiteren Gruppen, und zwar einer iranischen und einer idealtypischen, ergänzt. Das idealtypische Konstrukt wurde durch die Analyse von Sekundärliteratur insbesondere über europäische „Zigeunergruppen“ erarbeitet.
Dabei wurde berücksichtigt, daß indische, iranische und europäische „Zigeuner“ hinsichtlich wesentlicher kultureller Besonderheiten zueinander in starkem Kontrast stehen; in Religion, Sprache, Kleidung, gesellschaftlichem Kontext und dem jeweils eigenen Geschichtsbild unterscheiden sie sich aufs deutlichste voneinander. Der hiermit einhergehende Kontrastvergleich läßt aber auch die Möglichkeit zu, die dennoch bestehenden Gemeinsamkeiten der drei so verschiedenartigen Gruppen festzustellen und zu untersuchen.
Ziguenerleben im Orient
Der Verfasser prüft die Ursachen für diese Gemeinsamkeiten und unterzieht sie einer soziologisch angelegten Analyse, aus der heraus er seine Theorie über die Beziehung zwischen Produktionsweise und Ethnizität entwickelt. Dieser Theorie liegt die Hypothese zugrunde, daß spezifische Lebensweise und ökonomische Tätigkeit gemeinsame Eigenschaften verschiedener „Zigeunergruppen“ seien, die zur Erklärung ihrer jeweils gegebenen sozialen Position wesentlich beitragen können.
Die Arbeit M. Reza Hamzeh’ees besteht aus zwei Hauptteilen, nämlich einem deskriptiven und einem analytischen Teil, wobei uns das gedankliche Ineinandergreifen beider Teile als durchaus gelungen erscheint. Der Aufbau der Arbeit ist stringent und vollzieht sich im Dienst der genannten Fragestellung, deren für die Soziologie innovativer Charakter dem gewählten Anspruch vollkommen gerecht wird. Dabei zeigt der Verfasser eine angesichts des interdisziplinären Themas beeindruckende Literaturkenntnis; Veröffentlichungen wurden sinnvoll ausgewertet und fruchtbar genutzt. Daß einige themenspezifische ältere z.B. arabische Publikationen nicht herangezogen wurden, fällt dabei nicht weiter ins Gewicht.
Zunächst stellt der Verfasser die indischen Ghorbati als eine „zigeunerartige“ Gruppe vor, deren soziales und kulturelles Leben er auf den von ihm geplanten Wegen erforscht hat. Die Schlußfolgerungen hieraus sind ebenso überraschend wie von überzeugender Wirkung: die Ghorbati sind unter bestimmten Lebensumständen zu einer „zigeunerartigen“ Gruppe geworden, wobei ihnen die soziale Identität als „Zigeuner“ zufiel, die sie für sich annahmen bzw. anzunehmen gezwungen waren.
Eine vergleichende interdisziplinäre
Der Begriff „Zigeuner“ wird demnach jenseits herkömmlicher ethnologischer oder historiographischer Ansätze definiert und konstituiert sich als Ergebnis sozio-kultureller Dynamik im Wechselverhältnis zur Mehrheitsbevölkerung und der eigenen Suche nach sozialer Verortung im gegebenen gesellschaftlichen Gefüge. Wenn der Verfasser verschiedentlich davon schreibt, er beschäftige sich hauptsächlich mit „iranischsprachigen Zigeunern und zigeunerartigen Gruppen“, so wäre es für den nachfolgenden wissenschaftlichen Zugriff nicht ganz ohne Bedeutung, zwischen „Zigeunern“ und „zigeunerartigen Gruppen“ eine bis auf weiteres gültige Unterscheidung zu treffen, die im eben beschriebenen Sinne zu denken wäre.
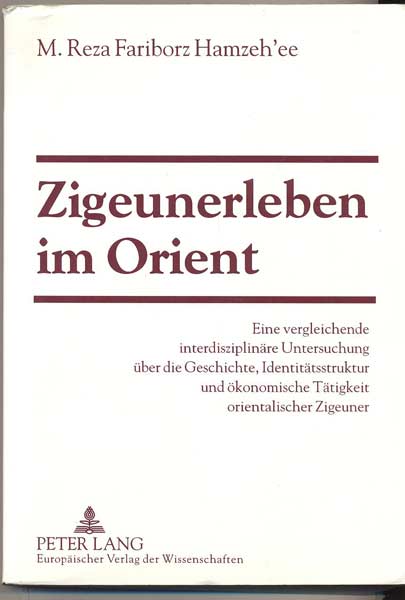
Die bisherige „Zigeunerforschung“ krankt ja ganz entschieden daran, daß sie zwar mit sozialwissenschaftlichen Instrumentarien und Positionen hantiert, bei der Betrachtung ethnischer Minderheiten aber doch in vielen Fällen der Begriff der „Ethnie“ gleichsam als Synonym für „Rasse“ gelten muß, um die ins Augenmerk genommene Gruppe überhaupt quantitativ benennen zu können. Auf der anderen Seite findet sich bei (europäischen) „Zigeunern“ partiell auch heute noch ein Eigenbild, das in starkem Maße ethnisch abgeleitet ist. Daraus ergeben sich für die sozialwissenschaftlich intendierte „Zigeunerforschung“ Konfliktpotentiale, die – soweit ich sehe – in entscheidenden Bereichen bis heute nicht entschärft werden konnten.
Interessant ist die Position des Verfassers, der bei den Ghorbati forschte und u.a. auch Legenden, Mythen usw.
bei der Beschreibung des Verlaufs der Ethnienbildung berücksichtigte, wobei er die kurdischen Kauli quasi als Vergleichsgruppe heranzog: M. Reza Hamzeh’ee vertritt die Ansicht, eine „Ethnie“ könne verschwinden oder an die Stelle einer anderen treten. Wörtlich schreibt er (S. 177), eine andere könne „geboren“ werden. Eine ethnische Gruppe könne schrumpfen, weil Teile davon abfielen, und andere Ethnien könnten sich vergrößern, weil sich ihr weitere Gruppen anschlössen. Und tatsächlich zeigt die historische Sozialforschung, wie stark ethnische Gebilde z.B.
in Deutschland im Laufe der zurückliegenden 150, 200 Jahre Veränderungen gezeigt oder gar zum Verschwinden gebracht worden sind. Damit ist keineswegs der radikale Prozeß physischer Eleminierung gemeint, sondern Prozesse der Assimilierung, der Wanderbewegung und Heimat-findung, der sozialen Ausgrenzung oder des Anpassungsdrucks und Kräfte der Integration, die von außen auf Gruppen einwirkten, sowie solche Prozesse, die aus den betreffenden Gruppen selbst Veränderungen evozierten.
Bei den Ghorbati zeigen sich weitere Beispiele für solche Veränderungsprozesse: Durch politische Ereignisse mußte sich eine alte Ethnie neu orientieren und eine andere Gestalt annehmen. Die Zersplitterung der Ethnie der Ghorbati führte dazu, daß sich ein Teil der Ethnie abspaltete und zu einer kleinen, selbständigen Ethnie wurde, die durch die ihr eigene Dynamik ihre Loyalitätsbasis umstrukturierte und Mythen, Symbole, Organi-sation und Führerschaft neu schuf bzw. neu formulierte. Was die Ghorbati angeht, so haben diese sich, wie der Autor belegt, in relativ kurzer Zeit eine neue Identität geschaffen, die ihre ethnische Grenze durch verschiedene kulturelle Eigenschaften bezieht und bestimmte Legenden und Mythen nutzt, um diese neue Ethnie zu rechtfertigen und zu stabilisieren.
Rezension Ziguenerleben im Orient: Bitte klicken Sie hier
Ziguenerleben im Orient
Damit verbindet sich zu recht die Frage, aus welchen Gründen die Schaffung einer neuen Ethnie den Ghorbati gelang, wenn doch in anderen Fällen der Entwicklungsprozeß erlahmt und das „soziale Experiment“ der Entstehung einer neuen kulturellen Gruppe mißlingt. Der Autor bietet eine Reihe einleuchtender Faktoren an, etwa die Existenz eines gemeinsamen geographischen Gebietes und die religiöse Vorstellung eines für alle Gruppenmitglieder gleichermaßen waltenden Gottes, um der weiter vorne erwähnten „materiellen Kultur“, den ökonomischen Tätigkeiten, hohe Bedeutung beizumessen.
Die Ghorbati sind hauptsächlich mit Handel beschäftigt und zeigen, wie der Autor bei seinen Forschungen feststellte, eine wohl prägnante zigeunerische Lebensweise, die sich von der der viehhaltenden Nomaden abhebt. Nach Feststellung des Verfassers existierten in der Region Kermânshâh schon immer Nomaden- und „Zigeuner“gruppen, wobei diese durch eine schwer überschreitbare ethnische Grenze von allen anderen Bevölkerungsgruppen ferngehalten wurden. Dennoch nimmt der Autor an, daß die Ghorbati sich auch aus einem Teil der iranischen Bevölkerung zusammensetzen, die unter bestimmten Umständen eine zigeunerische Lebensweise übernommen habe, wobei solche Umstände in der iranischen Geschichte häufig vorgekommen seien.
Der Autor vertritt die Ansicht, daß die Ghorbati zumindest teilweise ehemals zur seßhaften Bevölkerung gehört haben müssen. Die Veränderung ihrer Produktionsweise – die selbstverständlich an den Bedürfnissen der Konsumenten orientiert werden mußte und nach wie vor an ihr orientiert ist – trug zur Veränderung ihrer ethnischen Identität maßgeblich bei. Die Ghorbati gaben ihre seßhafte Lebens- und Produktionsweise auf und entwickelten ein Wanderleben, so daß aus der damit verbundenen neuartigen Produktionsweise wiederum zwingend ein Wandel der Ethnizität hervorging.
Ziguenerleben im Orient
Dies leuchtet ohne weiteres ein, könnte jedoch noch etwas stärker und vor dem Hintergrund der Tatsache diskutiert werden, welche sozialen und kulturellen Begleiterscheinungen gegeben sein müssen, um die Ethnizität einer Gruppe so dominant an der jeweiligen Produktionsweise oder – allgemeiner gesagt – ökonomischen Tätigkeit zu orientieren. In manchen Ländern Europas jedenfalls fanden bzw. finden wir das geschilderte Phänomen mit umgekehrten Vorzeichen: Hier beharrten die betreffenden Gruppenmitglieder meist auf gewohnten, traditionsreichen Erwerbstätigkeiten, deren Überflüssiggewordensein oder Nischenfunktion sie zunehmend verarmen ließ, ohne daß sich hieraus vorderhand die ernsthafte Suche nach neuartigen Erwerbsquellen zwingend ergeben hätte.

Dies Problem ist gerechterweise auch aus einem anderen Blickwinkel bewertbar: Die Mehrheitsgesellschaft zeigt gewöhnlich derartig heftige Mechanismen der Ausgrenzung und Unterdrückung, daß es einer (ethnischen) Minderheit bzw. Randgruppe unmöglich bleibt, aus der gegebenen sozialen Isolation auszubrechen und etwa durch eine bestimmte Art der „sozialen Karriere“, über Schulbildung, Berufstätigkeit, verändertes Sozialverhalten usw. die Veränderung der einmal gewachsenen Lebens- und Berufswelt herbeizuführen.
Die Bedingungen im Iran sind, wie die vorliegende Studie eindrucksvoll zeigt, in dieser Hinsicht völlig anders gelagert, aber immerhin räumt der Autor ein, daß „Zigeuner-Identität“ nicht sofort nach der Aufnahme einer neuen Produktionsform und einer neuen Lebensweise geändert werde, zumal die Produktionsweise selbst sehr anpassungsfähig sei und variabel auf Einflüsse der Umwelt reagiere, da sie auf sozialen Ressourcen fuße, die einem schnelleren Wechselintervall als Natur-Ressourcen unterlägen.
M. Reza Fariborz Hamzeh’ee
Reza Hamzeh’ee weist darauf hin, daß außer der Veränderung der Produktionsweise ohnehin weitere Gründe die Entstehung der Ghorbati als „Zigeunergruppe“ maßgeblich beeinflußt hätten. Hier nennt er u.a. den Umstand, daß internationale Krisen bei der Entstehung neuer ethnischer Identitäten determinierend gewirkt haben; die Schließung der Grenzen zwischen dem Iran und Indienim 17. und 18. Jahrhundert könnten hierbei eine Rolle gespielt haben. Vor der genannten Krise waren die Ghorbati, wie die Arbeit belegt, zwischen beiden Ländern als Pferde- und Edelsteinhändler tätig.
Die Schließung der Grenzen zwang sie dazu, sich einer neuen Produktionsweise zuzuwenden. Zudem sahen sie sich veranlaßt, sich andere geographische Räume zum Wandern und Handeln zu erschließen, und auch soziale und kulturelle Beziehungen und Traditionen wurden zwangsläufig einer Umstrukturierung und Neudefinition unterzogen. Der Autor stellt fest, daß die genannten politischen Ereignissen einen Teil der iranischen Ghorbati separiert und sie zur Bildung einer neuen Ethnie veranlaßt hätten. Als weitere Möglichkeit, die Ethnienbildung zu erklären, diskutiert der Autor die moderne Urbanisierung der indischen Gesellschaft, die entscheidend die Seßhaftigkeit der Ghorbati veranlaßt haben könnte.
Ziguenerleben im Orient
Aus neuen Lebensformen heraus könnte sich die von ihm beobachtete und beschriebene Ethnienbildung gestaltet haben. Der Autor diskutiert die verschiedenen Möglichkeiten und die unter Umständen zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge ausführlich und überzeugend. Schließlich führt er das Phänomen einer „zweiten Identität“ bzw. das „mehrerer Identitäten“ in bezug auf die Ghorbati an. Er konstatiert, daß der Wandel kollektiver Identität mit dem Wechsel der Produktionsweisen einherging, die er als „Schlüsselmerkmal“ und konstitutives Element für „Zigeuner“ als ethnische Gruppe im Nahen Osten bezeichnet. Auf sekundärer Ebene seien Selbst- und Fremdzuschreibungen für die ethnische Identität von Bedeutung, wobei Selbst- und Fremdzuschreibungen von mehreren objektiven Faktoren abhängig sind.
Es ist verständlich und richtig, daß der Verfasser seine Annahmen nicht über eine „mittlere Reichweite“ hinaus geltend machen will und etwa im Zusammenhang mit europäischen „Zigeunern“ diskutiert, obgleich er auch hierzu einige Anmerkungen und Vergleiche in seine umfangreiche Arbeit einrückt, deren besondere Stärke darin liegt, daß vor dem Hintergrund relevanter Literatur und verknüpft mit Ergebnissen der historischen Sozialforschung sich eine breit angelegte empirische Studie entfaltet, die den in heutigen Zeiten eminent wichtigen Begriff der Ethnie in Verbindung mit ökonomischer Tätigkeit problematisiert, um die Identitätsstruktur der untersuchten Gruppen herauszuarbeiten.
شکی نیست که نویسنده به موضوع خود تسلط دارد، که از رویکرد استدلالی جامعهشناختی خود استفاده میکند تا به مجموعهای از نتایج مهم تبدیل شود که در مجموع، کمک مهمی به تحقیق نشان میدهند.
پروفسور دکتر فیل دکتر. rer. soc هابیل یواخیم اس. هومن
مقدمه، پیشگفتار و فهرست مطالب کتاب: زندگی زیگ در مشرق زمین اثر محمد رضا فریبرز حمزه ای

 فارسی
فارسی